
House of Cards kennt jeder, Serienfans sicher auch Shameless. Vor den sehr erfolgreichen US-Versionen gab es allerdings schon herausragende Originale aus UK. Aber warum ein Remake, wenn sie gute Quoten hatten und hochwertig produziert wurden? Ein Grund leuchtet natürlich schnell ein: Sie sind technisch nicht auf dem aktuellen Stand, alle wollen doch immer das Neueste sehen. Es steckt aber noch einiges mehr dahinter.
Unterschiedliche Länder heißt auch immer: unterschiedliche (Serien-)Traditionen. So haben sich die USA und UK im Fernsehbereich sehr unterschiedlich entwickelt. So sind ein hoher Anspruch und die Tendenz zu Quality Television Series ein Grundzug des britischen Fernsehens. Da sind die Briten ganz weit vorn. Zu nennen wären Sherlock oder Doctor Who. Man könnte UK auch als kreatives Zentrum der europäischen Serienentwicklung bezeichnen. Auf der Insel wurden schon immer großartige Serien produziert, aber die waren international meist nicht von großer Bedeutung.
In UK ist das Fernsehen ein öffentlicher Dienst (Stichwort: „public service“) und hat deswegen hohe Ansprüche. Die Serientradition in den USA ist aber etwas anders zu betrachten. Dort gab es immer ups and downs – vor allem bezüglich der Qualität. Es gibt zudem viel mehr Anspruchsgruppen, zum Beispiel die Networks und – oh Wunder – einen enormen Einfluss der Werbekunden.
Also alles nur geklaut? Hier lest ihr 6 gute Gründe, warum Remakes doch Sinn machen.
1. Shortbread in den USA? Identifikation mit Figuren, Kultur und Land
Gleiche Sprache, gleiche Kultur? Briten und Amerikaner sind sich ungefähr so ähnlich wie Burger und Shortbread. In Sachen Humor, Lebensstil, Werten oder auch Politik. Stellt euch vor, in einer britischen Serie würde die Todesstrafe verhängt werden. Und Tea Time in Washington? Wohl eher nicht.
Beispiel House of Cards: Francis Urquhardt aus dem britischen Original könnte seine Intrigen in den USA so gar nicht spinnen – die politischen Systeme sind einfach viel zu unterschiedlich. Und was natürlich im US-TV nicht fehlen darf: Sex. Dementsprechend geht es in Frank Underwoods Beziehung zu Zoe Barnes heiß her – im Gegensatz zu der britischen Version. Ganz zu schweigen vom berühmten Dreier in der zweiten Staffel. Auch ist es kaum ein Zufall, dass Veronica im britischen Shameless weiß und blond, im Remake aber Afroamerikanerin ist. Die Anpassung von Optik (z. B. die Wohnsiedlungen), Sprache, kulturellen Besonderheiten usw. bringen die Serie dem Zuschauer näher und sorgen für Identifikation, auch wenn das Thema noch so abgedreht sein mag.
2. “Fuck you, fuck you, and especially fuck you!” – Sprache und Humor
Die Briten sind berühmt für ihren trockenen und mitunter sehr schwarzen Humor. Das war wohl zu viel für die Amis – die setzen in Remakes eher auf „American optimism”.
Auch sprachlich unterscheidet sich auf beiden Seiten des Teiches einiges – das geht los mit dem Dialekt und hört auf mit den Flüchen. Während man wohl selbst als Muttersprachler in der britischen Version von Shameless kaum ein Wort versteht, werfen die Amis (vor allem im Privat-TV) mit “Fuck” um sich, was das Zeug hält.
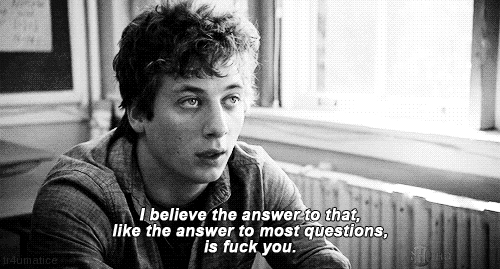
3. Who the fuck is Frank? – Bekannte Gesichter
Wer hat nicht schon eine Serie nur angefangen zu gucken, weil ein bestimmter Schauspieler mitspielt? In einer eigenen, landestypischen Version einer Serie kann man auch nationale Stars unterbringen. Und selbst wenn nicht immer die großen Namen für ein Remake verpflichtet werden können, sind die Darsteller in der Regel bekannter als die Schauspieler des Originals. Während William H. Macy (der dauerhaft betrunkene Familienvater aus Shameless) bereits aus anderen Serien bekannt ist, ist sein britischer Gegenpart David Threlfall eher wenigen außerhalb des Vereinigten Königreiches geläufig. International etablierte Schauspieler sind besonders für einen On-Demand-Anbieter wie Netflix wichtig, der internationales Publikum mit Inhalten versorgt. Werden national etablierte oder eben bekannte Schauspieler für ein Remake engagiert, kann dies die Popularität oder mediale Aufmerksamkeit enorm steigern – was sich am Ende finanziell auszahlt. Netflix gelang dies, indem Kevin Spacey für die Neuverfilmung von House of Cards mit an Bord geholt wurde.

4. It’s all about the money – Budget und Kosten
Das hört man ja immer wieder, wieso sollte es bei Serien anders sein? Die USA haben mehr Mittel zur Verfügung, um die Geschichte größer und aufwendiger als ihre „Vorbilder“ zu erzählen. Britische Serien werden meist unter hohem Druck und mit wenig Budget produziert, mit dem Anspruch auf hohe Qualität. Woran liegt das? Nun, Fernsehen ist nicht gleich Fernsehen. Das oftmals staatliche britische TV macht in der Regel keine Werbeeinnahmen, während amerikanische Sender entweder Geld für (oftmals lange) Werbeunterbrechungen oder mit Gebühren für Kabelsender einnehmen.
Eine durchschnittliche UK-Serie liegt bei ca. 800.000 USD pro Folge. Die USA legen für eine Folge auch mal 3 bis 4 Millionen auf den Tisch. Noch einmal deutlicher: die ersten beiden Staffeln von House of Cards kosteten Netflix ca. 100 Millionen Dollar. Da kann das Original aus UK kaum mithalten.
Dabei ist es nicht unbedingt zu teuer, für einige Millionen eine eigene Version einer Serie komplett selbst zu produzieren. Die Sender müssen meistens zwischen kostspieligen Lizenzen und den Kosten für eine eigene Produktion abwägen. Geld verdienen lässt sich dabei meist bei der Produktion und nicht bei der reinen Weiterverbreitung von Lizenzprodukten. Ein Produzent kann also höhere Gewinne mit einer eigenständig produzierten Version erzielen.

5. Uff, schon wieder Werbung
Wir kennen und lieben oder hassen sie alle: die Werbepausen. Super, um was zu knabbern oder zu trinken zu holen oder sich kurz aufs stille Örtchen zu verziehen. Oder eben unglaublich nervig. In den USA gehören Werbepausen im öffentlichen Fernsehen genauso dazu wie bei uns. In Großbritannien eher seltener. Britische Produktionen brauchen daher, im Gegensatz zu amerikanischen, meist keine Cliffhanger in einer Episode, um die Zuschauer zu halten. Eine britische Produktion ins öffentliche Fernsehen in Amerika zu übernehmen kann also riskant sein. Im Zweifel verliert man so auch Zuschauer, wenn vor der notwendigen Werbepause kein Anreiz entsteht, danach wieder einzuschalten oder dranzubleiben.
Auch Produktplatzierungen innerhalb der Serie spielen sicherlich eine Rolle – in den USA und in UK werden schließlich nicht immer die gleichen Marken vertrieben.
6. Verschiedene Länder, verschiedene Sehgewohnheiten
Aber nicht alle Gründe sind rein finanzieller Natur. Auch muss man beachten, dass es in den USA und UK gänzlich unterschiedliche TV-Märkte bzw. Systeme gibt. Dementsprechend haben sich einige typische Merkmale entwickelt, an die sich das Publikum gewöhnt hat. So haben britische TV-Shows im Schnitt nur 6 Episoden pro Staffel – das erscheint uns Deutschen und vor allem den Amerikanern dann doch herzlich wenig. Daher passen diese Staffeln auch nicht in die Struktur der US-TV-Sender, wo eine Staffel mit 22-26 Episoden die Norm ist. Wird ein Remake produziert, müssen weitere Plotlines geschaffen oder Nebenfiguren ausgebaut werden, um diese “Leere” und ein Fernsehjahr zu füllen. Ein Sender hat schließlich Interesse daran, mit einer Serie möglichst viel Sendeplatz einer Season zu füllen. Und mit nur 6 Folgen geht das dann doch eher schlecht. House of Cards liefert dazu ein perfektes Beispiel. Das Original hat nur 4 Episoden pro Staffel, die Netflix-Variante bietet 13 Episoden. Dass diese deutlich höhere Zahl an Sendeminuten auch anders gefüllt wurde, zeigt der Charakter von Claire Underwood. Im Original ist sie eine nahezu unbedeutende Randfigur, die US-Variante macht sie zur wichtigen Hauptfigur mit eigenen Storylines und vielen (bösen) Plänen. Dafür gab es 2014 sogar einen Golden Globe. Jedoch eignet sich Shameless nicht als Beispiel für die typische Episodenzahl, da die UK-Version im Schnitt mehr Episoden pro Staffel hat als die US-Variante.

Fazit: Alles Copycats, oder was?
Damit sich das Publikum besser in eine Serie hineinversetzen kann und sie besser annimmt, kann es also durchaus sinnvoll sein, wenn Inhalte, Look, Feeling und Tonalität an Bekanntes und Gewohntes angepasst werden. Kritiker könnten jetzt mosern, dass sich die Amis dann gefälligst eigene Geschichten ausdenken sollen. Ja, könnten sie, und tun sie auch. Schließlich ist es auch eine Form von Tribut an das Original, es künstlerisch weiterzuentwickeln und eine (zeitgemäßere) Version zu produzieren.
Natürlich sind die hier angeführten Argumente nicht erschöpfend und lassen sich auch nicht auf alle Adaptionen anwenden. Am Ende macht es wohl wieder einmal die Mischung und vor allem eine gute Geschichte, wie auch Netflix-Gründer Reed Hastings in einem Interview mit FAZ.net sagte. Und oft kommt man erst durch ein gutes Remake dazu, sich auch das Original anzusehen. Also: adaptieren heißt nicht gleich kopieren.








































Kommentiere
Trackbacks