
Eben noch tanzt die junge Whitney Elizabeth Houston mit ihrer besten Freundin im Wohnzimmer, im nächsten Moment sitzt sie schon am Tisch des Musiklabels Arista und unterschreibt ihren ersten Plattenvertrag. Das Biopic „Whitney Housten: I Wanna Dance With Somebody“ hetzt nur so durch die Vita der schillernden Popsängerin. Dabei wird vieles nur angedeutet und manches sogar ganz ausgespart. So geht es leider vielen Filmen, die die Karrieren von Musiklegenden im Schnelldurchlauf abfrühstücken. Spätestens seit dem Erfolg von „Bohamian Rhapsody“ über Freddie Mercury und Queen kann man als Kinogänger:in regelmäßig mit musikalischem Filmnachschub rechnen. Ob Elvis‘ Hüftschwung von Austin Butler in „Elvis“ oder Elton Johns einprägsame Outfits in „Rocketman“ – sie alle erzählen ähnliche Geschichten vom Aufstieg und allzu oft auch vom Niedergang einzelner Musiker:innen oder Bands. Zwar kann das Heimkino bei den wenigsten von uns mit der Tonqualität eines Kinosaals mithalten, aber die oft jahrzehntelangen Karrieren scheinen mir geradezu prädestiniert für eine Darstellung im Serienformat.
Biopics über Musiklegenden in Serie
Danny Boyle zeichnete mit „Pistol“ in einer sechsteiligen Miniserie die Story der englischen Punkband Sex Pistols nach. Wu-Tang Clan-Mastermind RZA erzählte seine Geschichte der neunköpfigen Rap-Gruppe in drei Staffeln. Ursprünglich war ein Kinofilm à la „Straight Outta Compton“ geplant. Stattdessen setzte er sich mit seiner Vision einer groß angelegten Serie durch. Die Serie „Wu-Tang: An American Saga“ schafft es, neben der musikalischen Arbeit auch die individuellen Schicksale der Protagonisten zu schildern. Das funktioniert so gut, dass man nicht einmal die Crew oder Rap mögen muss, um das Drama zu genießen.

Ich würde mir mehr solcher Serien wünschen, die das künstlerische Schaffen vertiefen und dabei unterhaltsamer sind als eine Dokumentation. Die Lebensgeschichten von Musiker:innen sind oft vielschichtig und komplex. Serien bieten den nötigen Raum, um die verschiedenen Aspekte zu erforschen. Ganze Staffeln könnten sich der Entstehung eines Albums widmen oder ein Jahrzehnt abbilden. So können auch Motivationen und Hintergründe besser beleuchtet werden. Außerdem können Live-Auftritte, Studioaufnahmen und sogar Videodrehs viel länger gezeigt werden, anstatt mehrere Songs in einem kurzen Medley unterzubringen. Wie Musikgeschichte und persönliches Drama auf packende Weise miteinander verknüpft werden können, zeigte Anfang des Jahres die Musikserie „Daisy Jones & The Six“ über eine fiktive Rockband in den 1970er Jahren.

Wenn Schauspieler Kingsley Ben-Adir (bekannt aus „Secret Invasion“) nächstes Jahr als Reggae-Legende Bob Marley auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird oder Jaafar Jackson seinen verstorbenen Onkel Michael Jackson in dem kommenden Biopic mit dem schlichten Titel „Michael“ verkörpert, kann man sich schon jetzt auf eine hastige Rückschau der Musikstars einstellen. Wer weiß, vielleicht bringt ja J.J. Abrams‘ Netflix-Serie über die irische Rockband U2, die gerade in Planung ist, die Wende.
Bilder: Hulu | Amazon Prime Video
























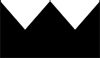




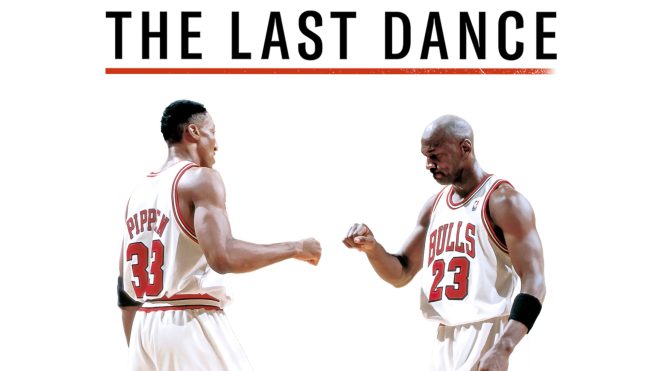

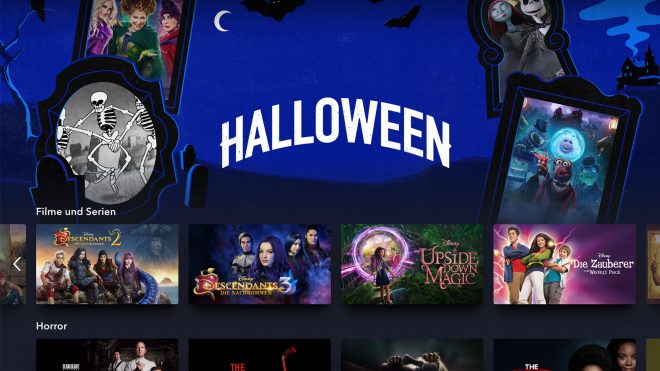








Wenn WALK HARD nicht gefloppt wäre, hätten wir jetzt vielleicht gar keine Musikerbiopics mehr.
Trackbacks