Oh, mal ein schwedisches Netflix-Original, direkt mal ausprobieren: „Liebe und Anarchie“ klingt erstmal vielversprechend. Die acht 22-minütigen Folgen spielen in Stockholm, eine meiner Lieblingsstädte. Davon gibt’s aber in der Netflix-Serie nicht allzu viel zu sehen (muss ja auch nicht sein, sonst rutscht es noch in so eine Klischeesache ab wie bei „Emily in Paris“, auch wenn Stockholm sicher weniger Klischeehaftes zu bieten hätte). Wir sind entweder bei Sofie, unserer Protagonistin, zu Hause, oder im Verlag, wo sie ihren neuen Job angetreten hat.

Ihre Aufgabe ist es, als Externe einem kleinen Verlag wieder auf die Beine zu helfen. Der leidet nämlich wie viele Verlage unter den Auswirkungen der Digitalisierung, wie es heißt, und braucht frischen Wind. So weit, so unspektakulär, und mit diesem unspektakulären Setting beginnen auch schon die Probleme, nicht nur des Verlages, sondern auch der Serie. In der ersten Folge wird ziemlich auf dem Gegensatz „Alte analoge Welt – neue digitale Welt“ herumgeritten, wobei auch allerlei Klischees bedacht werden. Der alteingesessene Lektor, der ein Händchen für gute, klassische Autoren hat, steht der jungen Lektorin gegenüber, die eine Schwäche für Nachwuchsautorinnen hat. Dann ist da noch die klassische Mitarbeiterin am Empfang, und der junge ITler, also alles relativ klassisch besetzt. Leider wird auf der Digitalisierung extrem viel herumgeritten, das nervt schnell. Auch die junge Praktikantin, die ständig am Handy bei ‚Insta‘ hängt, ist einfach zu stereotyp aufgebaut. Das setzt sich auch bei Sofie zu Hause fort, wo ihr Mann einfach allzu platt und banal inszeniert wird (ein freier Abend ohne Kinder, ein Weinchen dazu, und schon ist er nur allzu schnell zu allem bereit… naja).

Was ist die Story? Der ITler erwischt die neue Managerin dann am Abend in eindeutigen Posen an ihrem Laptop und schießt ein Beweisfoto, mit dem er sie in der Folge erpresst. Für ein einfaches Essen bei Burger King löscht er das Bild schon wieder, aber ab dem Punkt beginnt Sofie, den Spieß umzudrehen und das Spiel weiterzuspielen, Stichwort „Wahrheit oder Pflicht“. Das geschieht leider viel zu spontan, und man versteht auch gar nicht so recht, warum sie das Spiel jetzt weiterspielen möchte. Da hätte sich die Serie deutlich mehr Zeit nehmen können, was generell für die Charakterentwicklung insbesondere von Sofie betrifft. Offensichtlich ist sie in der Familie unzufrieden, aber das kommt gar nicht so richtig raus. Auch warum sie Tag für Tag auf dieses Wechselspiel mit dem ITler Max eingeht, wird nicht ganz klar. Irgendwann ist es offensichtlich sexuelles Interesse, aber bis das offenbar wird, da wird’s auch schon relativ banal erzählt und inszeniert. Schade eigentlich, dass man hier insbesondere das Potenzial von Sofie-Darstellerin Ida Engvoll (kennt man aus der Hauptrolle im oscarnominierten „A Man Called Ove“) verschenkt.

Dabei hat die Serie auch einige gute Momente, sie spielt es aber leider so gar nicht aus, sondern bleibt lieber an der simplen Oberfläche der Story. Spannend fand ich zum Beispiel Sofies Diskussion mit den Lektoren, als es darum geht, wie man die an sich schon sehr gute Geschichte der Autorin so umgestalten kann, dass es auch ein Verkaufserfolg wird. Die Literatur an sich steht nicht mehr im Vordergrund, sondern der größtmögliche Verkauf. Leider setzt „Liebe und Anarchie“ das nicht weiter fort. Auch die Geschichte zwischen Sofie und ihrem Vater wird immer nur angerissen – der Nebenhandlung hätte man sicher mehr Platz einräumen können. Oder später in der Serie folgt ein guter Ansatz, als der Verlag eine Kooperation mit einem Streamingdienst eingeht, um langfristig wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Hier nimmt sich Netflix in gewisser Weise selbst aufs Korn, ja sogar diese Serie selbst. Wie gestaltet man einen Serienstoff so, dass er zwar sicher keine cineastische Perle wird, sich aber gut verkaufen lässt? „Liebe und Anarchie“ geht dafür als extrem passendes Beispiel durch.



























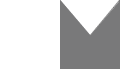
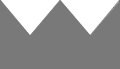
















Kommentiere
Trackbacks